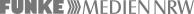Herr Claussen, universitäre Karriere und intellektuelles Renommee einerseits, jahrzehntelange Fußball-Begeisterung andererseits - ist das nicht ein kaum zu bewältigendes Spagat?
Nein. Schon in meiner Kindheit bin ich mit meinem Vater in Hamburg zum Fußball gegangen. Wir gingen oft zu Altona 93 in die Adolf-Jäger-Kampfbahn, die noch in den fünfziger Jahren „Kampfbahn“ und nicht Stadion hieß; also auch diese Art der Sprachgermanisierung, die leider zur Geschichte des Fußballs in Deutschland gehört. Aber wir wohnten in Hamburg-Bahrenfeld, und so war auch das Volksparkstadion relativ nah. Seit dieser Zeit ist für mich auch Herne ein fast mythischer Ort, denn so sah ich die Vorrundenbegegnung um die Deutsche Meisterschaft zwischen Westfalia Herne und dem HSV im ausverkauften Volksparkstadion. Eines meiner unvergessenen Spiele. In dieser Partie kam es zu dem berühmten Zusammenstoß zwischen Hans Tilkowski und Uwe Seeler, aus dem sich dieser spektakuläre Fallrückzieher Seelers zum 2:1 entwickelte. Den habe ich irgendwie von weit weg, aber immerhin live gesehen. Ich habe Jahre gebraucht, um wirklich zu fassen, was da passiert ist. Das ist einer dieser Glücksmomente, die mich beim Fußball gehalten haben. Wie Volker Finke mal sagte: „Für so einen Moment geht man jahrelang ins Stadion und es passiert nie - und dann ist man doch einmal dabei gewesen.“

„Seit dieser Zeit ist für mich auch Herne ein fast mythischer Ort...“. Westfalias-Torhüter Hans Tilkowski im Luftkampf mit Uwe Seeler vor fast 40.000 Zuschauern im Herner Stadion am Schloss Strünkede, Mai 1960.
Das heißt auch zu Ihrer späteren Zeit APO-bewegten Zeit im Frankfurter SDS sind Sie weiterhin auf den Fußballplatz gegangen?
In Frankfurt sind wir selbst in der bewegtesten Zeit zur Eintracht gegangen. Bei der WM 1970 haben sich die Leute gewundert, dass sich diese „hard-core SDS’ler“ in einer Kneipe trafen. Es waren wunderbare Spiele einer neuen Spieler-Generation. Selbst der deutsche Fußball hatte durch die Bundesliga einen riesigen Aufschwung genommen.
Man unterstellt dem deutschen Fußball Anfang der siebziger Jahre gerne ein libertäres Element?
Es wuchs eine neue fußballerische Generation heran, die sich ein bisschen mit den Abfallprodukten der anti-autoritären Bewegung identifiziert hat. Paul Breitner mit der Mao-Bibel war allerdings schon immer Show und Mache. In den Vereinen selber gab es die Brüche mit einer alten Generation von Trainer und Vorständen, die das nicht mehr gerafft haben, was da auf dem Platz passierte. Momente der Internationalisierung setzten ein, die in ihren positiven Auswirkungen völlig unterschätzt werden. Besonders die bornierten deutschnationalen organisatorischen Fußballtraditionen wurden aufgebrochen, und das tat allen sehr gut.

Netzers berühmtes Tor zum Gladbacher 2:1-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den 1.FC Köln 1973, nach dem er sich in der Verlängerung selbst eingewechselt hat.
Mit Spielern wie Günter Netzer etablierte sich der Fußball auch jenseits der Sportzeitungen als kulturelles Phänomen.
Dieser nicht mehr ganz neue Fußball-Feuilletonismus, der sich in den achtziger Jahren entwickelt hat, stört mich oft. Damals ist auch dieser „post festum Netzer-Kult“ oder „post-Netzer Netzer-Kult“ aufgekommen. „Netzer kam aus der Tiefe des Raumes“ - diese Formulierung wurde unheimlich bewundert. Netzer hat inzwischen durch seine televisionäre Dauerpräsenz begonnen, den eigenen Mythos, aber auch das Vertrauenskapital wieder zu zerstören, das er sich als Kritiker von Fehltendenzen erworben hatte. In der Sportpresse ist allerdings das argumentative Niveau inzwischen sehr gestiegen; sehen wir einmal von dem gepflegten Antiintellektualismus der Boulevardpresse ab. BILD appelliert an den Fußballdummkopf in der Gestalt der Expertenmeinung.
Hat die Aufladung des Fußballs zum Wirtschaftfaktor und das allgegenwärtige Fernsehen das Spiel kaputt gemacht?
Nein. Einer der besonders in Deutschland verbreiteten Fußball-Mythen ist, dass das Geld den Fußball kaputt gemacht hätte. So ist es nicht. Ein Problem in der deutschen Fußballgeschichte ist die sehr späte Einführung des Professionalismus, der nämlich erst dazu geführt hat, dass neben den mittelständischen Bürgersöhnen und Angestellten andere Schichten an diesem Spiel teilnehmen konnten. Der bürgerliche DFB hat als sportpolitische Organisation diese Entwicklung lange verhindert und den deutschen Fußball seit Ende der zwanziger Jahre blockiert. Die großen Stars aus der Arbeiterklasse sind nur unter den Bedingungen des Berufsfußballs möglich gewesen. Fußball blieb eben dadurch nicht diese bürgerliche „Gentleman-Sportart“, die er vor dem Ersten Weltkrieg noch war. Und da es in Deutschland keine Gentlemen gab, waren es die Militärs, die den Fußball zu pädagogischen Zwecken und zur Disziplinierung einsetzten. Vieles, was wir am deutschen Fußball nicht mögen, kommt aus dieser obrigkeitsstaatlichen Tradition.
Die Fußballrevolution der sechziger und siebziger Jahre haben wir auch der internationalen Professionalisierung des Fußballs zu verdanken: die Verbreitung von Spielsystemen, die Spieler, die einen größeren Horizont bekamen, und selbstverständlich auch die Trainer. Denken Sie nur an den Ungarn Béla Guttmann, das „Missing link“ der fußballerischen Moderne. Als Spieler wurde er 1925 mit Hakoah Wien österreichischer Meister und verbreitete später dieses wunderbar offensive „4:2:4 - System“ weltweit. Oder die große Mannschaft von Real Madrid der fünfziger Jahre, die auch deshalb funktionierte, weil die Vereinsführung Spieler wie Puskas und Di Stefano geholt hat, die in wilden Ligen spielen mussten oder wegen Flucht gesperrt waren. Und diese „Wundermannschaft“ wurde abgelöst von Benfica Lissabon. Das legendäre Endspiel im Europapokal der Meister 1962: Benfica – Real 5:3 - eines der größten Fußballspiele, das je gelaufen ist, und der Trainer bei Benfica hieß: Béla Guttmann. Der Professionalismus und das Fernsehen haben den Fußball erst zu dem globalen Spiel gemacht, an dem jeder Anteil nehmen kann.
Welche gesellschaftliche Bedeutung hat der Fußball bekommen?

„Die großen Fußballstars aus der Arbeiterklasse sind nur unter den Bedingungen des Berufsfußballs möglich gewesen.“ Der Erkenschwicker Horst Szymaniak hatte in den fünfziger Jahren noch als Bergmann unter Tage gelernt. In einem Interview sagte er: „Mein Vater war Bergmann, mein Bruder war Bergmann. Und viele Bergleute sind früh gestorben. Ich weiß nicht ob ich heute noch leben würde, wenn ich im Pütt geblieben wäre.“
Mich hat mal ein mexikanischer Freund in das WM-Stadion von Guadalajara eingeladen. Wir waren in den Kabinen, gingen durch diese Arena und unterhielten uns. Irgendwann sagte er zu mir: „Weißt Du, Fußball ist eine Ersatzreligion.“ Wir saßen in diesem legendären Stadion und plötzlich musste ich antworten: „Ich glaube, das stimmt nicht. Fußball ist eine Religion!“ - Über diesen Gedanken bin ich auf den Begriff der „Alltagsreligionen“ gekommen. Gesellschaftstheoretisch ist man oft verführt, zu sagen, kollektive Identifikationen wie die „Nation“ sind Ersatzreligionen und deren Herausbildung muss irgendwie mit der Säkularisierung, der Abnahme traditionell religiöser Identifikationen und Werte, zusammenhängen. Aber wie ist das gesellschaftsgeschichtlich miteinander verknüpft? Und in welchem Bezug stehen religiöse Vereinsgründungen wie Celtic Glasgow und Glasgow Rangers dazu? Es ist doch klar: Fußball ist eine Religion, und das, was wir als „das Religiöse“ normalerweise verstehen, geht mit dem Fußballreligiösen Hand in Hand. In einer Zeit, in der die althergebrachten Bindungen abnahmen, traten neue kollektive Identifikationen auf. Der DFB oder Schalke 04 sind vor 100 Jahre gegründet worden, in einer Zeit also, die als die klassische Phase der „Erfindung von Traditionen“ bezeichnet werden kann. England als „Mutterland des Fußballs“ ist das Land der „invention of tradition“. Aus der kontinental-europäischen Sicht sind wir oft neidisch auf die funktionierenden englischen Traditionen, aber wenn wir darüber nachdenken, sind es Erfindungen des späten 19. Jahrhunderts.